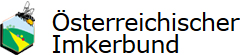Referat Ökologische Bienenhaltung
Jahresbericht 2024
Jahresbericht Öko-Bienenhaltung 2024
unter Downloads: der Jahresbericht 2024
Jahresbericht 2024 Referat für Ökologische Bienenhaltung
- Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit: Artikel in Bienen Aktuell, Homepages der Landesverbände
- Bildungsauftrag für die Bio-Bienenhaltung, insbesondere (neben Facharbeiter-, Meister- u. WL-Ausbildung) für die Imker-Neueinsteiger und Imker-Neueinsteigerinnen
- Organisation der Zusammenkünfte mit den Kolleginnen aus den Bundesländern, ob Online (mind. 1x jährlich) und in Präsenz (jährlich in Salzburg)
- Vorschläge für Änderung in der nächsten EU-Förderperiode(2028-2034) im ÖPUL, der EU-Bio-Verordnung und der SRL Imkereiförderung
Jahresbericht 2024 Referat für Ökologische Bienenhaltung
- Struktur
- Aufgaben und Aktivitäten des Referates für Ökologische Bienenhaltung
- Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit: Artikel in Bienen Aktuell, Homepages der Landesverbände
- Bildungsauftrag für die Bio-Bienenhaltung, insbesondere (neben Facharbeiter-, Meister- u. WL-Ausbildung) für die Imker-Neueinsteiger und Imker-Neueinsteigerinnen
- Organisation der Zusammenkünfte mit den Kolleginnen aus den Bundesländern, ob Online (mind. 1x jährlich) und in Präsenz (jährlich in Salzburg)
- Wesentliche Inhalte der Besprechungen mit den Landesreferentinnen und Landesreferenten
- Vorschläge für Änderung in der nächsten EU-Förderperiode(2028-2034) im ÖPUL, der EU-Bio-Verordnung und der SRL Imkereiförderung
- Aufgaben und Aktivitäten des Referates für Ökologische Bienenhaltung